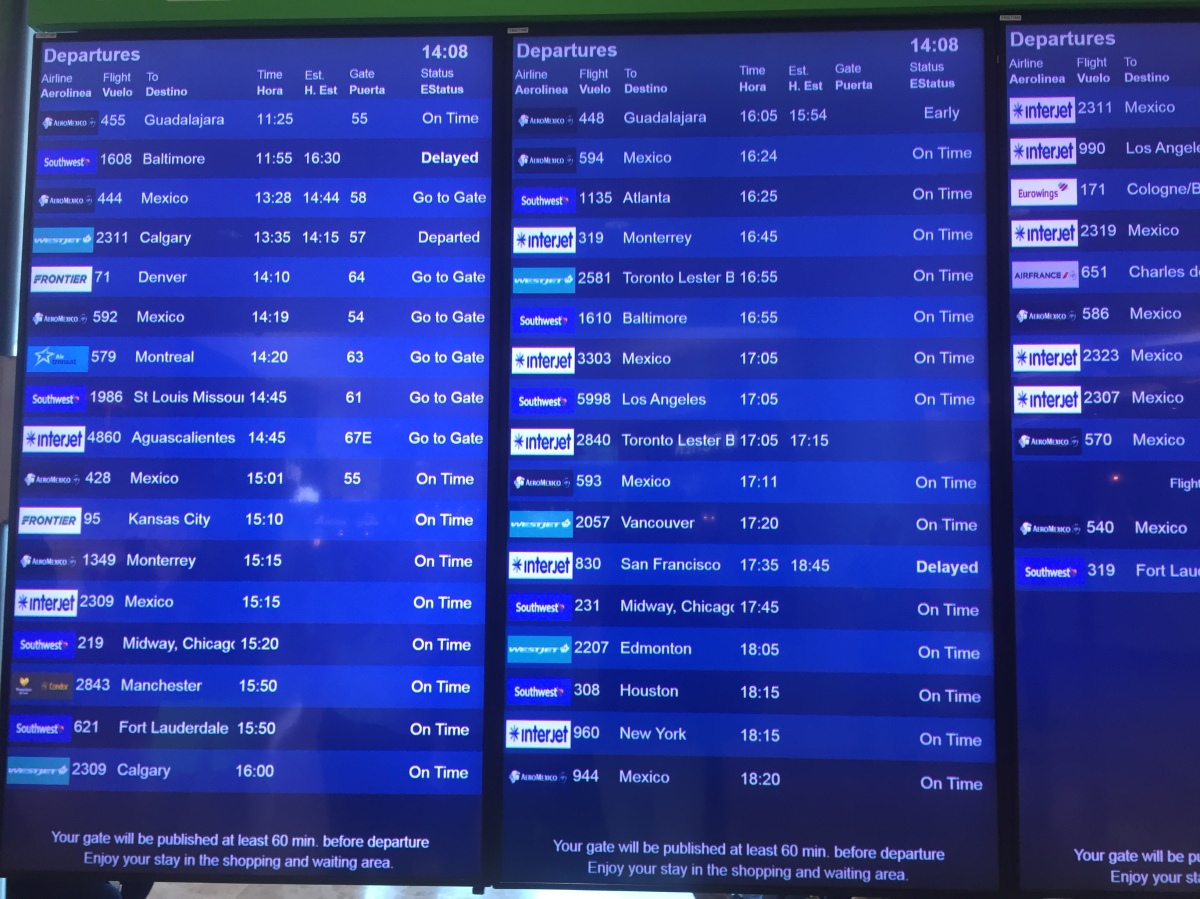Nach neun Stunden fährt der Bus die schachbrettartig angeordneten Straßen Meridas entlang und in meinem Kopf rechnet es: Die Zeit läuft ab. Im Vergleich zu San Cristobal und Oaxaca kann die Hauptstadt des Staates Yucatan szenisch nicht mithalten, aber aushalten kann man es in der angeblich sichersten Stadt Mexikos trotzdem.
Ich bin in einem guten Hostel und in guter Gesellschaft von zwei Deutschen (natürlich) und einer Griechin (immerhin). Im nahegelegenen Chichén-Itzá studiere ich noch kurz die Maya-Kalender, denn an der Ruinenstätte (die diesmal das Prädikat „eines der sieben neuen Weltwunder“) trägt, lässt sich der Zählwahnsinn (oder die Genialität) der Maya besonders eindrücklich bestaunen. Einen weiteren Tag muss ich außerplanmäßig im Hostel ganz in der Nähe des Klos verbringen, weil ich in einem Anflug von Unbesiegbarkeitsgefühl am Vorabend meine Pommes in Mayonnaise ertränkt habe, was einfach bei 35 Grad in einem hippen Outdoor-Foodcourt nicht die schlaueste Idee ist. Wäre ich doch bloß beim „echten“ Streetfood geblieben. Ich habe einen Tag Zeit, darüber nachzudenken und mir meinen Fehler nochmal durch den Kopf gehen zu lassen – im wahrsten Sinne des Wortes. Ich werde also doch nicht der erste Weltreisende sein, der es ohne Brechdurchfall geschafft hat.

Nachdem ich also auch diese Erfahrung abhaken kann, geht es weiter nach Tulum. In dem Hippieort an der Karibikküste beziehe ich mein letztes Quartier. Weil es unmöglich scheint, diesem Abenteuer einen krönenden Abschluss zu verpassen, nehme ich mir nicht zu viel vor. Auf der Dachterasse meines Hostels esse ich mein Müsli in Zeitlupe und beobachte mich selbst dabei, wie ich das drohende Ende meiner Odyssee wohl verkraften werde. Um mich abzulenken, quatsche ich das Mädel schräg gegenüber an, und wir versinken spontan in einer zweistündigen Unterhaltung. Vier Becher Kaffee und etliche Zigaretten später, leihen wir uns Fahrräder und ziehen los. Wir fahren zusammen zu den (ja, Überraschung!) nahegelegenen Maya-Ruinen, die hier direkt am Meer liegen und damit natürlich ebenfalls einzigartig sind.

Wir radeln umher, brutzeln am Strand in der Sonne, kaufen Tequlia als Mitbringsel, essen Tacos und trinken Bier. Der Begegnung wohnt dieser seltene Zauber inne, der einem das Gefühl gibt, man würde sein Gegenüber schon ewig kennen. Dabei sind es nur zwölf Stunden, die wir zusammen verbringen, bevor ich sie zum Busbahnhof bringe und wir uns verabschieden. Ich liege noch eine Weile wach im Bett und frage mich, ob es an meiner melancholischen Reiseend-Stimmung liegt, dass ich ihr am liebsten sofort hinterherfliegen würde oder ob ich gerade wirklich binnen weniger Stunden einen leichten „crush“ hatte. Alles kommt und geht so unfassbar schnell, wenn man unterwegs ist; Menschen, Orte, Gemütszustände. Wie soll ich mich bloß wieder auf die Abspielgeschwindigkeit des normalen Lebens einstellen?
Als der letze Tag anbricht, stehe ich an einem mit Wasser gefüllten Loch im Boden. Es ist der „El Pit“ genannte Eingang zum größten zusammenhängendem Unterwasserhöhlensytem der Welt, dem „Sistema Dos Ojos“. Vor etlichen Jahren habe ich mal eine Doku im Fernsehen über die Unterwasserhöhlen auf der Yucatan-Halbinsel gesehen und ich weiß noch ganz genau, wie ich dachte, dass es furchtbar schade ist, dass ich das niemals mit eigenen Augen sehen werde, weil ich ja gar nicht tauchen kann und wenn ich es doch könnte, würde ich ganz sicher nicht in so eine Höhle tauchen, weil ich ja schließlich nicht lebensmüde bin.
Heute habe ich keine Angst.
Ich mache den großen Schritt und verschwinde in der Unterwelt.
Was sich dann auftut, ist mit Worten nicht zu beschreiben. Die Höhle ist riesig und durch das Loch an der Decke fallen die Sonnenstrahlen ein. In 15 Metern tiefe, wo die sogenannte Sprungschicht (Halocline) das Salz- vom Süßwasser trennt, bricht sich das Licht in einem magischen Flirren. In ca. 30 Metern tiefe tut sich ein Geisterwald auf. Die toten schwarzen Bäume, die beim Einsturz der Höhlendecke hier runter gefallen sind, werden von Bakterien zersetzt, die eine dichte weiße Wolkendecke aus Schwefelwasserstoff inmitten die Höhle gezogen haben.
Es gehört zu den atemberaubendsten Dingen, die ich in meinem Leben gesehen habe.
Den zweiten Tauchgang beginnen wir am Eingang „Dos Ojos“ von wo aus wir in verzweigte Gänge vorstoßen und uns zwischen Stalaktiten und Stalagmiten hindurchschlängeln. So beklemmend die Vorstellung auch sein mag, tatsächlich war es ein Gefühl meditativer Entspannung. Gleichmäßige und ruhige Atmung, frische Atemluft auf dem Rücken, angenehm kühle 25 Grad Wassertemperatur, keine Strömung und man schwebt gemächlich, wie ein großes Raumschiff in einem Science-Fiction-Film durch unbekannte Welten. Es ist – man kann das nur so bezeichnen – ein erhabenes Gefühl.
Technisch gesehen ist es keine Raketenwissenschaft in eine Höhle zu tauchen; nur Angst darf man eben nicht haben.
Ich vermute mal, jeder Mensch hat mit seinen Ängsten zu kämpfen; und wer vor gar nichts Angst hat, ist wahrscheinlich ein Idiot und wird – mal rein evolutionsbiologisch gesehen – bald ohnehin nicht mehr viel zu melden haben. Angstfreiheit ist ein Zustand von Geisteskrankheit; Angstbesessenheit aber auch. Letztendlich ist es doch ein lebenslanger Kampf mit den Ängsten. Sei es im ganz Kleinen, zum Beispiel bei einer dunklen, gefluteten Höhle oder bei den großen (Verlust- und Versagens-)ängsten im Leben. Man kann seine Ängste vielleicht niemals vollständig besiegen, aber man kann – und muss! – die Oberhand behalten und ihnen gelegentlich den Mittelfinger rausstrecken.
Vielleicht wird diese Erkenntnis eines Tages die wichtigste Lektion sein, die ich auf dieser Reise gelernt habe.